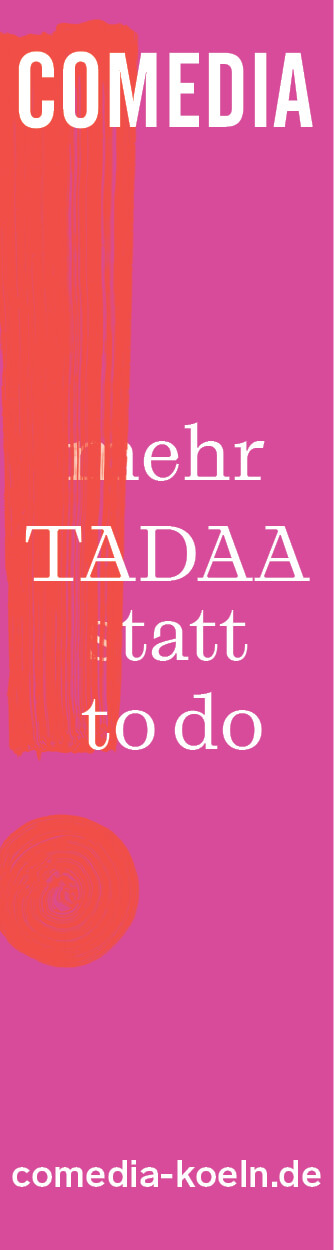„Die Gesellschaft muss ein Interesse daran haben, die Mieten niedrig zu halten“
Montag, 20. Juni 2011 | Text: Gastbeitrag | Bild: Tamara Soliz
Geschätzte Lesezeit: 9 Minuten
Köln und speziell die Südstadt sind massiv mit günstigem Wohnraum unterversorgt. Die Verwaltung hat Aufrufe gestartet, bittet Eigentümer, mithilfe öffentlicher Fördergelder preiswerten Wohnraum zu schaffen oder wenigstens bestehende Wohnungen als Sozialwohnung zur Verfügung zu stellen. 43 Prozent der Kölner hätten aufgrund ihres Einkommens Anspruch auf eine geförderte Wohnung mit Wohnberechtigungsschein. Es sind aber nur Wohnungen für acht Prozent vorhanden, bei fallender Tendenz. Was kann man dagegen tun? Das wollten wir von Michael Schleicher wissen. Der ehemalige Postbeamte, Polizist und Sozialwissenschaftler ist Leiter des Amts für Wohnungswesen der Stadt Köln.
Meine Südstadt: Herr Schleicher, überall in der Literatur wird die Südstadt als Musterbeispiel für einen „durchgentrifzierten“ Stadtteil genannt. Wie funktioniert Gentrifzierung, aus bauwirtschaftlicher Sicht?
Michael Schleicher: Wir sehen das derzeit auch in Ehrenfeld, Kalk, Mühlheim: Periodisch zieht der Markt an. In der ersten Phase gibt’s eine einfache Sanierung, dann passiert 10, 15 Jahre nichts. Dann wird der Bedarf immer stärker, die Normenqualität steigt, andere Normen werden entwickelt. Sagen wir: Die Qualität der Altbauten steigt durch Einfachssanierung. In der nächsten Phase kommt eine weitere, noch bessere Sanierung. Dann Luxusneubauten. Dadurch schieben sich die Preise immer weiter nach oben. Dort wo der Arbeitsmarkt gut ist, entwickelt sich automatisiert der Wohnungsmarkt. Nehmen wir die Altstadt Süd, das berühmte Beispiel Microsoft. Wenn Microsoft nach Köln zieht, ziehen 80 kleine Firmen nach – alles Leute, die gut verdienen. Die Nachfrage nach Lofts, nach größeren 3-Zimmer-Wohnungen steigt. Ein Haus in der Südstadt, das erst einmal einfach umgebaut wurde, wird durch diese Nachfrage noch mal umgebaut und weiter modernisiert.
Und wer sich das nicht leisten kann, muss gehen. Ist das Ihrer Ansicht nach ein Prozess, dem die Stadt entgegensteuern sollte?
Die gesetzlichen Bestimmungen sind begrenzt. Ein Beispiel: In einem Altbau auf der Kurfürstenstraße wohnt eine siebenköpfige türkische Familie. Dann entscheidet sich der Hauseigentümer, zu sanieren und aus der großen zwei kleine Wohnungen zu machen. Er bekommt dafür eine Teilungsgenehmigung – die ist ihm nicht zu verwehren, es gibt rechtlich ja keine Gründe, denn es sprechen keine statischen Zweifel dagegen. Oben drauf kann er auch noch ein 120-Quadratmeter Loft setzen, wenn er will. Ebenso verhält es sich mit Baulücken: Die darf der Eigentümer so bebauen, wie er will solang er sich ans Bau- und Nachbarschaftsrecht hält. Ob er die Wohnungen dann für 20 Euro den Quadratmeter vermietet oder öffentlich gefördert für 5,10 Euro, entscheidet er komplett alleine.
Es gibt aber ein stadtplanerisches Steuerungsinstrument: den Bebauungsplan. Wie ein größeres Grundstück bebaut wird, wie es genutzt werden darf, darüber kann die Stadt entscheiden.
Das ist richtig. Dadurch gibt sie vor, was ein potenzieller Eigentümer dort machen darf. In Köln gibt es zumindest innenstädtisch wenig Flächen, die man noch so gestalten kann. Aber hin und wieder tun sich Möglichkeiten auf. Am Waidmarkt etwa, auf dem Gelände des ehemaligen Stadtarchivs. Die Stadt wird dort über Stadtentwicklungsplanung ein städtebauliches Konzept entwickeln. Es gibt verschiedene Interessen und Eigentümer – mein Ziel als Leiter dieses Amtes ist es, dort auch öffentlich geförderten Wohnungsbau zu schaffen. Und zwar insbesondere senioren- und altengerechtes Bauen, das heißt, mit möglichst vielen Kleinwohnungen, barrierefrei, seniorengerecht und günstig. Ich habe sowohl einen Bauträger als auch einen Käufer, der uns garantiert, dass dort öffentlich geförderter Wohnraum entsteht.
In den letzten Jahren hat die Stadt fünf Mehrgenerationenprojekte im sozialen Wohnungsbau gefördert. Nun reines Seniorenwohnen – ein Trend?
Für mich ist die Gruppe derjenigen, die wegen des demographischen Wandels Wohnungen brauchen, derzeit die wichtigste Gruppe neben Familien mit Kindern. Wir haben da jetzt schon ein enormes Problem. 1.000 Euro ist eine gute Rente – eine 2-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt kostet aber 600 Euro! Wenn man über 40 Prozent oder wie viele Rentner 70 Prozent – seines Nettoeinkommens an Miete ausgibt, dann ist das für viele Menschen schlichtweg nicht mehr machbar.
Außerdem geht das gesamte Konsumklima einer Stadt den Bach runter. Die Rentnerin hat dann für ihre Enkel und Kinder keinen Cent Geld mehr übrig. Diese Menschen konsumieren alle nicht mehr: Sie gehen weniger essen, gehen weniger in die Kneipe, kaufen weniger Kamelle im Kaufhof. Wenn man davon ausgeht, das 50 Prozent der Kölner eine niedrige Rente haben und wenn sie alle auch noch in zu teuren Wohnungen wohnen, was der Fall ist – sie wohnen für 7, 8, 9 statt für 5,10 Euro, dann wird nichts mehr konsumiert. Das Konsumklima einer Stadt ist der Mengeneffekt und nicht die Einzelinvestition.
500.000 Leute, die jeden Tag essen gehen, lösen ein anderes Konsumklima aus als 20.000, die regelmäßig hochpreisig essen gehen. Die Stadt muss also als Gesamtgesellschaft ein Interesse daran haben, die Mieten niedrig zu halten.
Klingt logisch. Trotzdem ist Köln mit öffentlich geförderten, günstigen Wohnungen eklatant unterversorgt. 1.300 neue Wohnungen müssten pro Jahr gebaut werden, um den Bedarf zu decken.
Festgelegtes Ziel mit den Mitteln, die wir haben, ist es, wenigstens 1.000 neue geförderte Wohnungen pro Jahr zu bauen. Dafür tue ich alles mir Mögliche. Teilweise baut die Stadt selbst, größtenteils sind es aber andere Träger, wie die GAG oder Privatinvestoren.

Ein Projekt der Stadt Köln: Sozialwohnungsbau in der Kulmbacher Straße
Wie funktioniert dieses Bauen und warum ist es so unattraktiv? Es scheint sich für Investoren nicht zu rentieren, zum Leidwesen der Bevölkerung.
Es ist eine Frage der Ideologie. Auch mit gefördertem Wohnungsbau kann man Geld verdienen. Die Baupreise sind aufgrund der Vorschriften mehr oder weniger gleich. Der Unterschied zwischen öffentlich und frei finanziertem Bauen ist ein rechnerischer. Wie teuer kaufe ich das Kapital an? Nehme ich öffentliche Mittel zu 0,5 Prozent oder nehme ich Mittel vom der Bank für zurzeit 4 Prozent Zinsen? Aus dieser Differenz entsteht die Miete, die bei öffentlich gefördertem Wohnungsbau dann bei nur 5,10 Euro liegt und 20 Jahre niedrig bleiben muss, bevor sie schrittweise auf die Marktmiete angehoben werden kann. Hinzu kommt die Frage: Wie viel Prozent Gewinn will man machen? Sollen es 12 Prozent sein, 20 Prozent oder gar solche Leute kenne ich auch 30 Prozent? Die muss man dann auf die Finanzierung oben drauf setzen. So kommen Mieten von 10, 12 , 15 Euro zustande.
Die Frage, welchen Weg man geht, ist natürlich die entscheidende Frage in einer Welt, in der die meisten nur das Maximum wollen.
Schauen wir uns die Südstadt und Bayenthal an. Nur in Lindenthal gibt es weniger Sozialwohnungen die Deckung bei uns liegt bei unter drei Prozent, während sich im Kölner Norden die Sozialwohnungen ballen. Chorweiler hat einen Anteil von fast 25 Prozent Sozialwohnungen am Gesamtbestand. Der Süden ist unterversorgt!
Tatsächlich sieht es in der Südstadt derzeit schlecht aus mit den Perspektiven für günstigen Wohnraum. Zwar gibt es kfw- und Landesmittel für altersgerechtes Sanieren. Die wollen die meisten aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie dann eine angepasste Mietobergrenze haben. Und es wird wenig Neues entstehen, weil es wenig verfügbaren Raum gibt. Bei ein paar Baulücken können wir noch Beratung machen, aber auch das liegt am Willen des Eigentümers. Die Stadt selbst hat neben dem Waidmarkt nur noch ein Gelände auf der Trierer Straße solche Flächen würde ich gerne mit preiswerten Wohnungen bebauen.
Wenn, wie in den letzten Sozialwohnungen der Südstadt, die Niedrigmietbindung von geförderten Wohnungen ausläuft, was passiert dann?
Was die bestehenden Sozialwohnungen angeht: Wenn die Bindung heute ausläuft, darf sich die Miete erst nach etwa fünf Jahren auf Marktniveau befinden. In der Regel entstehen nach diesen langen Zeiten auch Nachsanierungsproblematiken die Wohnungen müssen erneut saniert werden. Das kann man auf zwei Weisen tun, und alles Entscheidende spielt sich dabei im Kopf des Eigentümers ab. Wenn er sagt: Ich fühle mich verantwortlich, günstigen Wohnraum zu belassen, dann kann er mit kfw-Mitteln zu zwei Prozent sanieren. Dann bewegt sich die Mieterhöhung in 20 Jahren allenfalls über diese zwei Prozent aber er könnte wunderbar das Kapital zurückholen. Wenn der Vermieter dagegen sagt: Ich möchte die Ex-Sozialwohnung hochsanieren, dann kann er es tun.
Es gibt doch keine Privatperson, die sagt: ich fühle mich weiter verantwortlich. Nehmen Sie das Beispiel Rheinauhafen und dessen Effekt für das Stollwerck-Areal: Dort befürchten die Bewohner von Ex-Sozialwohnungen zurecht, dass der Komplex nach Ablauf der Bindung hochsaniert und an wohlhabendere Eigentümer verkauft wird. Der Verkauf beginnt schon.
Es gibt nur eine Stadt in Deutschland, die ein Mittel zur Sicherung sozialen Wohnens gefunden hat: München. Das heißt dort sozialgerechte Bodennutzung. Inwiefern das für die Bestandspolitik greift, bin ich noch unsicher. Zumindest für die Neubaupolitik würde das bedeuten: Bei Neubauvorhaben muss immer ein Anteil x günstiger Wohnraum entstehen. Am Gerling-Komplex wäre das dann so. Wenn etwas Ähnliches per Gesamtbeschluss im Kölner Rat entschieden würde, würde das unser Wohnraumproblem sehr schmälern. Es gibt hier Teile der Kölner Politik, die stehen dahinter, andere Teile glauben, das regelt der Markt. Es ist eine Frage der Ideologien der Parteien.
 Michael Schleicher, Leiter des Amts für Wohnungswesen der Stadt Köln, im Gespräch mit Judith Levold und Dorothea Hohengarten.
Michael Schleicher, Leiter des Amts für Wohnungswesen der Stadt Köln, im Gespräch mit Judith Levold und Dorothea Hohengarten.
Die städtische Aktiengesellschaft GAG, mit 42.000 Wohnungen der größte Vermieter der Stadt, verkauft von ihren 650 Wohnungen in der Südstadt 200 bzw. hat das schon getan, nach Ablauf der Sozialbindung. Kölnweit wurden auf diese Weise bereits über 2.000 Wohnungen privatisiert. Ist das der richtige Weg für eine Stadt, die bekennend unter Sozialwohnungsnot leidet?
Die GAG hat eine Berechtigung bei auslaufenden Bindungen die Mieten anzuheben. Das ist eine durchaus moralische Entscheidung. In diese Wohnungen sind jahrelang öffentliche Mittel reingeflossen. Die GAG hat das 20, 25 Jahre lang abfinanziert, es gibt ohnehin nur noch ein Restkapital. Wenn man das jetzt sauber auf das Objekt hin finanziert, nur die restlichen noch verbleibenden Kapitalmarktmittel, braucht man keine teure Miete zu nehmen. Ist aber möglicherweise der Standard nicht mehr ok., sagen wir, man muss seniorengerecht sanieren, dann nimmt man kfw-Mittel zu zwei Prozent und Bestandsinvest (Sanierungsmittel, Anm. d. Red.), und so hat man wieder eine Wohnung für 5,10 Euro. Darüber, was wirtschaftlich genug ist, entscheidet letztlich der Aufsichtsrat, denn die GAG ist eine Aktiengesellschaft.
Und genau das ist das Problem. Ob eine AG bei städtischen Aufgaben wie der Versorgung mit Wohnraum immer zielführend ist ich bezweifle das. Der Vorstand ist betriebswirtschaftlich gezwungen, gewinnbringend zu wirtschaften. Kein Aufsichtsrat, die Stadt schon gar nicht, kann einen Vorstand zwingen irgendetwas zu machen, das nicht betriebswirtschaftlich ist.
Aber so wie Sie es beschrieben haben, wäre ein Beibehalten der Sozialbindung ja nicht unwirtschaftlich.
Es ist eine Frage der Darstellung. Und genau da muss der Aufsichtsrat Einfluss ausüben. Man kann die Preise stabil halten und muss das Wohnen nicht teuer machen. Die Frage der Gewinnmaximierung in der Gesamtgesellschaft ist eher das Problem. Wenn alles auf Gewinnmaximierung reduziert wird, dann kauft es irgendwann eine Heuschrecke, wie Elad eine israelische Immobiliengruppe – die den halben Kölnberg aufgekauft hat.
Sie beziehen sich auf den massiven Aufkauf von privat gebauten Sozialwohnungen durch Immobiliengesellschaften und Fonds. Haben wir in Köln ein Heuschrecken-Problem?
Es ist noch nicht so dramatisch wie im Ruhrgebiet oder in Teilen Bonns, aber Finkenberg (Hochhaussiedlung in Köln-Porz, die als sozialer Brennpunkt gilt, Anm. d. Red.) etwa ist bereits an die Firma Thalos verkauft worden, die entwickelt sich in Richtung Wien und weiter. Die Tendenz zum Heuschreckenaufkauf ist auf jeden Fall da.
Auf der Bergisch-Gladbacher Straße wissen wir zum Beispiel von einem Haus, das Annington gehört. Dort kostet die Miete 9,30 Euro, unmöglich hoch, davon gehen 60 Cent in amerikanische Rentenfonds. Und die Leute, die da wohnen, sind an der ALG II-Grenze. Das heißt: Von denen, die da wohnen, konsumiert kein Mensch mehr. Annington vermietet diese Wohnung per Internet, die Schlüssel werden mit der Post zugeschickt.
Nächstes Jahr brauche ich 110 Millionen Euro, um Chorweiler vor den Heuschrecken zu retten.
Das heißt, die Stadt muss mitbieten, damit die einst mit öffentlichen Fördermitteln gebauten Wohnungen heute nicht den Bach runtergehen?
Kaufen ist nicht alles. Wenn wir kaufen, müssen wir investieren, 60 Millionen für die Sanierung. Das würde eine Heuschrecke gar nicht machen, also muss sie das auch nicht einkalkulieren.
Sie machen sich seit Jahren stark für die Idee, dass geförderter Wohnungsbau auch ein Instrument zur Integration sein muss, dass es darauf ankommt, die soziale Mischung wiederherzustellen. Dann müssten Sie doch großes Interesse an der Dombrauereibrache in Bayenthal haben so eingebettet zwischen zwei schicken Stadtteilen wäre das das perfekte Land dafür….
Absolut. Aber die Brache befindet sich im Landesbesitz – die Stadt Köln hat keinerlei Entscheidungskompetenz, allenfalls über bestimmte baurechtliche Entscheidungen. Und es gibt keine abgeschlossene Verwaltungsmeinung, die der Oberbürgermeister herstellt zu diesem Thema. Ich hätte also keine Berechtigung, da etwas einzubringen. Selbst wenn ich eine Idee hätte – wenn der Eigentümer sie nicht teilt, würde es nichts nützen.
Ich muss 1.000 preiswerte Wohnungen im Jahr bauen. Es ist schwer genug, diese Menge zu produzieren. Ich glaube nicht, dass ich dafür unbedingt diese Fläche brauche. Ich kann nur sagen: Wenn man sich entscheidet, auf dieser Brache irgendwann preiswert zu bauen, muss es ja nicht unbedingt eine 15-Euro-Wohnung werden. Auch wenn sie nicht öffentlich gefördert wird, kann sie günstig sein.
Welche Rolle spielen Genossenschaften bei der Schaffung von günstigem Wohnraum?
Wenn man sich etwa Genossenschaften wie die Bremerhöhe in Berlin anschaut, dann könnten sie ihre wichtige Rolle beibehalten. Das Problem ist nur, dass die meisten Genossenschaften, auch in Köln, mittlerweile die Gewinnmaximierung zur Leitidee erhoben haben. Die Grundidee des solidarischen Bauens für den Kleinen Mann dagegen scheint zu sterben.
Wenn ich beruflich weinen könnte, würde ich das etwa beim Gedanken an die Vorgebirgsgärten tun (eine von vier Genossenschaften gebaute Wohnanlage mit Mietquadratmeterpreisen von 9,20 bis 11 Euro, Anm. d. Red.). Wir hätten das gleiche bauen können für 5,10 Euro, aber wir haben das Rennen verloren.
Das Problem dahinter ist ein Generationenwechsel in den Vorständen vor etwa fünf bis sechs Jahren. Die Genossenschaften haben entschieden: Wir wollen freie Marktunternehmer werden. Das werden wir nicht, wenn wir öffentlich gefördert bauen. Als Jungunternehmer muss man Gewinne vorzeigen können. Und man nimmt keine Assis, die von der Stadt in Sozialwohnungen zugewiesen werden. Auch wenn sich seit nunmehr drei Jahren die Genossenschaften ihre Mieter in den geförderten Wohnungen selbst aussuchen können, kehren sie nur in Ausnahmefällen zum geförderten Wohnungsbau zurück. Aber ich bin unbesorgt: Wenn die Zinsen auf dem Kapitalmarkt wieder steigen, kommen sie wieder. Da bin ich mir sicher.
Das Interview führten Dorothea Hohengarten und Judith Levold.
Dir gefällt unsere Arbeit?
meinesuedstadt.de finanziert sich durch Partnerprofile und Werbung. Beide Einnahmequellen sind in den letzten Monaten stark zurückgegangen.
Solltest Du unsere unabhängige Berichterstattung schätzen, kannst Du uns mit einer kleinen Spende unterstützen.
Paypal - danke@meinesuedstadt.de
Artikel kommentieren