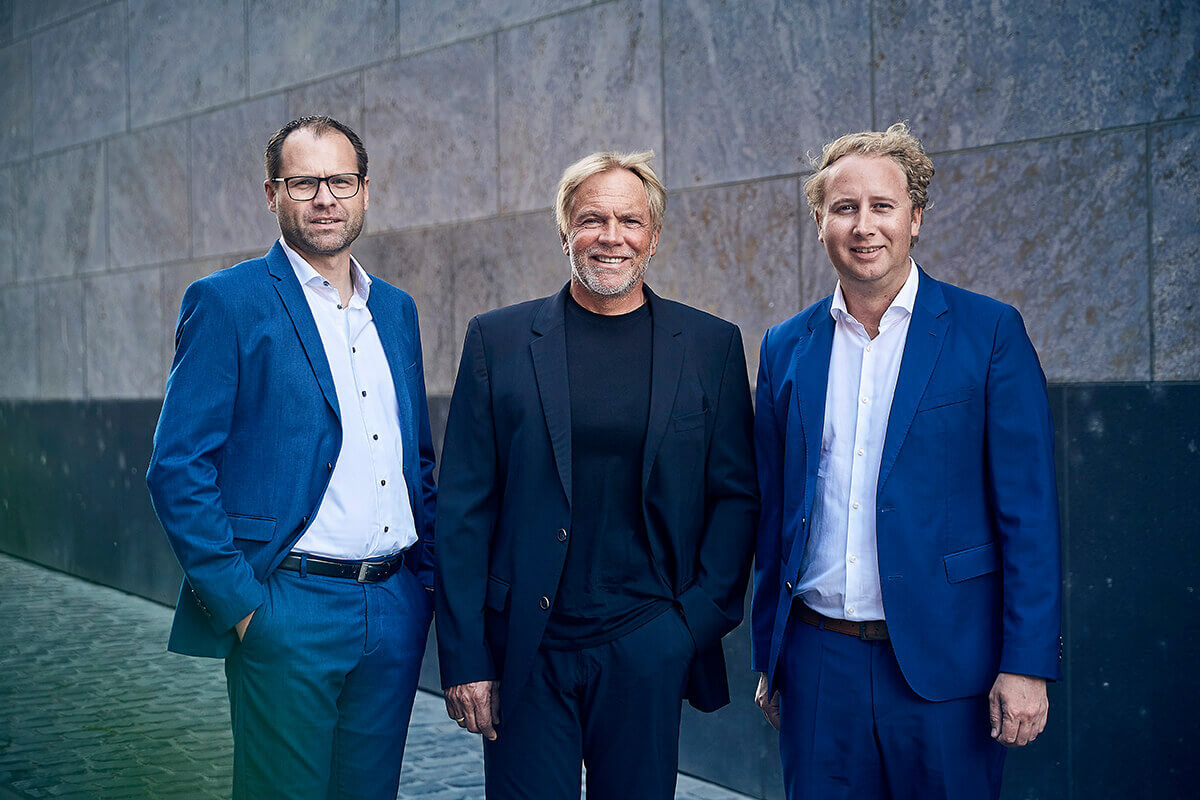Höhenluft und Gorillascheiße – Reise nach Uganda Teil 2
Montag, 15. August 2011 | Text: Stephan Martin Meyer | Bild: Stephan Martin Meyer
Geschätzte Lesezeit: 9 Minuten
Ruwenzori-Gebirge ++ Lage: an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo ++ Höhe: Bis zu 5100 Meter ++ Ausdehnung: 160 Kilometer Nord-Süd, 50 Kilometer Ost-West ++ Touristische Erschließung: kaum ++ Wege: schlammig. Fortbewegung: zu Fuß ++ Steigung: steil!
Der 8000-Seelen-Ort Kilembe schmiegt sich in ein überbordend grünes Tal am Fuße des Ruwenzori. Die Straße ist vollständig mit Schlaglöchern gepierct, Kinder bevölkern die Wege und kleinen Häuseransammlungen. Bananenstauden und Bohnenanpflanzungen stellen die Existenzgrundlage dar. Ein kleines Backpackers ist der Ausgangspunkt einer Wanderung, von der im Vorfeld niemand ahnte, wie schwierig sie sein würde. Und das war auch gut so, denn sonst hätte keiner von uns die Strapazen des Aufstiegs auf sich genommen.
Sieben deutsche Touristen, drei ugandische Guides, 24 Träger. Acht Tage Fußmarsch liegen vor uns. 3175 Höhenmeter sollen überwunden werden. Quer durch den Dschungel und über steile Felswege.
Kilembe befindet sich bereits auf 1667 Metern Höhe und der erste Tag bringt einen Aufstieg über 1503 Meter mit sich. Während sich auf den ersten Metern noch Wiesen und Felder mit buntgefleckten Kühen, die sehr an Norddeutschland erinnern, erstrecken, tauchen wir bald in die afrikanische Graslandschaft ein. Papyrus, drei Meter hoch, streckt sich majestätisch der Sonne entgegen. Feuchtigkeit und Wärme lassen jede Pore des Körpers umgehend aktiv werden. Die teure Funktionskleidung verweigert bereits nach einer halben Stunde ihren Dienst, nur die festen Wanderschuhe halten das, was sie versprechen noch, denn hier sind die Wege trocken.
 Bald umfängt uns dichter Dschungel. Riesige Bäume, Farne mit über drei Meter langen Fächern, Lianen, die bis an den Boden reichen und faszinierende Flechten umgeben die Eindringlinge. Mit jedem Schritt wird der Weg steiler, doch der Blick in die von Grüntönen und Vogelgesang vollgestopfte Landschaft rechtfertigt die Anstrengungen. Der Weg ist im unteren Bereich noch gut ausgebaut, die Pflanzen, denen wir beim Wachsen beinahe zusehen können, werden mit Macheten im Zaum gehalten. Erster Nebel wabert gespenstisch auf uns zu und umgibt uns immer wieder vollständig.
Bald umfängt uns dichter Dschungel. Riesige Bäume, Farne mit über drei Meter langen Fächern, Lianen, die bis an den Boden reichen und faszinierende Flechten umgeben die Eindringlinge. Mit jedem Schritt wird der Weg steiler, doch der Blick in die von Grüntönen und Vogelgesang vollgestopfte Landschaft rechtfertigt die Anstrengungen. Der Weg ist im unteren Bereich noch gut ausgebaut, die Pflanzen, denen wir beim Wachsen beinahe zusehen können, werden mit Macheten im Zaum gehalten. Erster Nebel wabert gespenstisch auf uns zu und umgibt uns immer wieder vollständig.
In der Bambuszone, die sich wie ein Gürtel um das gesamte Gebirge schlingt, fliehen Schimpansen vor den ungewohnten Lauten der Menschen. Schillernd rote Vögel fliegen über unsere Köpfe. Der Weg erreicht eine Steigung von fast 45°, ohne Anstalten zu machen, sich hin und wieder abzuflachen. Die Träger, die wir hinter uns wussten, überholen uns mit einem fröhlichen Gruß auf den Lippen im Dauerlauf. Wir Europäer brauchen dringend eine Pause. 3000 Meter Höhe. Eine Rast unter knorrigen Bäumen, 15 Meter hoch, die sich als Pflanzen herausstellen, die ich von meinem Balkon kenne: Erika. Auch hier wieder Nebel, oder sind es schon Wolken? Die Stimmung wird gespenstisch. Auf einem kleinen Hügel tauchen plötzlich menschliche Bauwerke auf: Tunnelzelte. Und eine Holzhütte. Unser erstes Camp, das wir glücklich erreichen.
Die Nacht in der Höhe ist unruhig, die Luft zunehmend dünner. Ab 3000 Metern wird das Atmen schwieriger. Und der zweite Tag der Tour wird noch einmal über 400 Meter Aufstieg mit sich bringen. Die Guides raten uns zu Gummistiefeln. Von Stund an werden wir uns nur noch mit diesen fortbewegen. Die Pfade sind feucht, schmale Bäche kreuzen fortwährend unseren Weg. Schlamm vor uns, hinter uns und auch bald in den Stiefeln und an den Hosen, bis zu den Waden. Die Brücken über größere Wasserläufe bestehen nur mehr aus feucht-rutschigen Baumstämmen. Über lange Strecken begleiten uns die Erika-Bäume, dicht bewachsen mit Flechten und von Feuchtigkeit schweren Moosbüscheln. Jeder Blick zurück lässt das ohnehin schon arg beschäftigte Herz schneller schlagen: Berge überall. Nebel steigt aus den Tälern auf, in der Ferne ruhen ausgedehnte Seen, durchteilt von der ugandisch-kongolesischen Grenze.
 Unser Weg führt uns an meterhohen Lobelien vorbei und scheint am Rande eines Sumpfes, der den Kessel eines flachen Tales füllt, zu Ende zu sein. Doch die Strünke riesiger Grasbüschel werden zum Steg, der durch teils waghalsige Sprünge gemeistert werden muss. Ein Schritt daneben bedeutet schnell, bis zum Knie im sumpfigen Wasser oder Schlamm zu versinken. Ist der Gummistiefel erst einmal verschwunden, dann gibt der Sumpf ihn nicht gerne zurück. Die Höhe wirkt sich nach und nach deutlich auf Fauna und Flora aus: Hier leben so gut wie keine Insekten mehr. Vögel sind kaum noch zu zu sehen oder hören. Blüten sehen wir selten. Die Landschaft wird mehr und mehr lebensfeindlich.
Unser Weg führt uns an meterhohen Lobelien vorbei und scheint am Rande eines Sumpfes, der den Kessel eines flachen Tales füllt, zu Ende zu sein. Doch die Strünke riesiger Grasbüschel werden zum Steg, der durch teils waghalsige Sprünge gemeistert werden muss. Ein Schritt daneben bedeutet schnell, bis zum Knie im sumpfigen Wasser oder Schlamm zu versinken. Ist der Gummistiefel erst einmal verschwunden, dann gibt der Sumpf ihn nicht gerne zurück. Die Höhe wirkt sich nach und nach deutlich auf Fauna und Flora aus: Hier leben so gut wie keine Insekten mehr. Vögel sind kaum noch zu zu sehen oder hören. Blüten sehen wir selten. Die Landschaft wird mehr und mehr lebensfeindlich.
Das Erreichen des zweiten Camps ist mit dem Glücksgefühl der sicheren Landung nach einem Flug durch einen Sturm vergleichbar. Schuhe und Kleidung wechseln, essen, schlafen. Die Wünsche reduzieren sich auf ein Minimum. In der Nacht im Tunnelzelt unter einem enormen Felsvorsprung ist an Schlaf nicht zu denken. Das Herz rast, die Luft ist dünn, der Regen fällt prasselnd auf die glücklicherweise dichte Plane über meinem Kopf. Die Erschöpfung hat mich voll im Griff.
Tag drei. 442 Höhenmeter. Der Blick nach oben lässt die Muskeln zittern. Lobelien, Felsen, Moose, Wasser, Grasbüschel, Nebel. Feuchtigkeit dringt in alles ein. Jedes Tal, in das uns der Weg hinunter führt, verspricht einen steilen Aufstieg an seinem Ende. Eine weit ausgedehnte Hochebene empfängt uns unfreundlich mit seinen Sümpfen und dem kargen Bewuchs. Zunächst bemerke ich es kaum, doch der Weg scheint sich zu bewegen. Der Blick ist wie in einem Tunnel auf den nächsten Schritt konzentriert. Irgendwo vor mir sind meine Mitstreiter, der Abstand wird größer. Hinter mir beobachtet mich Edson, einer unserer Guides, aufmerksam. Vermutlich hat er es viel früher bemerkt als ich. Meine Schritte werden langsamer, ich nehme die Landschaft kaum noch wahr. Schwindel setzt ein.

Ich habe davon gehört, ich habe mich damit beschäftigt und zugleich habe ich gehofft, dass sie mich nicht erfasst. Die Höhenkrankheit. Wen sie erwischt, das weiß im Vorfeld niemand zu sagen. Und es gibt nur eine Heilmethode dagegen: Runter gehen. Mich irritiert, dass ich auf Schwedisch denke. Körperliche Anstrengung, dünne Luft, das Wissen, es weiter nach oben geht. Immer weiter hoch. Die Beine versagen ihren Dienst. Schlamm bedeckt die Hose bis zum Knie. Eine Talsenke. Die anderen warten, haben besorgte Gesichter. Nur nicht sprechen. Auf Grasbüscheln kann man auch sitzen. Irgendwie.
Die Guides entscheiden. Für mich ist die Wanderung hier zu Ende. Edson wird mich begleiten. Ein Träger eilt nach oben, ruft Mizuki zurück. Er hat meinen Rucksack. Ich gehe runter. Nicht zum letzten Camp zurück, sondern quer durch die Berge zum Camp sechs. Mit jedem Schritt fällt mir das Atmen leichter. Leben kehrt in meinen Geist zurück. Ich erreiche das Camp, bin erschöpft und heilfroh, nicht wieder nach oben zu müssen. Ausruhen, das ist alles, was ich mir wünsche.
Im Camp treffe ich auf Göran und Eva aus Stockholm. Sie haben die gesamte Route bewältigt und steigen schon wieder ab. Ich schließe mich ihnen an. Edson joggt am nächsten Morgen wieder nach oben zu meiner Gruppe. Von den Schweden erfahre ich Details über den Zustand der weiter oben liegenden Camps (große Zelte, hoch gefüllt mit Wasser, in denen Schaumstoffmatratzen schwimmen) den Wegen (steil, vereist, lebensgefährlich) und das Wetter (Schnee am Morgen, Regen tagsüber).
Der nun für mein Wohlbefinden zuständige Guide Shawn überredet uns, den Tag mit einem klitzekleinen Aufstieg zu beginnen. Der Matinda-Lookout liegt mit seinen 4000 Metern Höhe fast senkrecht über den Zelten des Camps. Wir nehmen ihn in Angriff. Ein Träger folgt uns, doch als er das mitgenommene Seil an einer steilen Stelle an einem Baum befestigt, höre ich Shawn hinter mir: I think, they will handle it! Göran und Eva sind ein paar Jahre älter als ich. Pensionierte Weltenbummler. Triathleten. Sie meistern den Aufstieg erheblich geschickter als ich (dafür bin ich dann später beim Abstieg schneller). Bei strahlender Sonne steigen wir auf, der Blick von oben verspricht grandios zu werden. An einer Stelle erhebt sich der Felsen vor uns fast senkrecht nach oben. Krüppelige Bäume wachsen im rechten Winkel aus der Felswand. 15 Meter überwinden wir, indem wir durch das Geäst steigen. Steph, whats up? erschallt es von unten. Shawn steht breit grinsend auf einem Ast unter mir. Wolken türmen sich düster vor uns auf. Der Gipfel empfängt uns mit einem Ausblick auf die weiße Feuchtigkeit, die uns auf allen Seiten umgibt. Keine freie Sicht für niemanden.
 Der Abstieg zum Backpackers dauert zwei Tage. Jeder Schritt bringt mich der Zivilisation näher. Und der damit verbundenen Dusche. Trockene, saubere Kleidung wird zum größten Wunsch. Erika, Bambus, Dschungel und Graslandschaft fließen an mir vorbei. Der Blick wird klarer, die Sonne ist häufiger zu sehen, ein richtiges Bett steht am Ende der Tour. Ich habe es geschafft. Überlebt, ohne größeren Schaden zu nehmen. Alles was danach kommt, ist ein Spaziergang.
Der Abstieg zum Backpackers dauert zwei Tage. Jeder Schritt bringt mich der Zivilisation näher. Und der damit verbundenen Dusche. Trockene, saubere Kleidung wird zum größten Wunsch. Erika, Bambus, Dschungel und Graslandschaft fließen an mir vorbei. Der Blick wird klarer, die Sonne ist häufiger zu sehen, ein richtiges Bett steht am Ende der Tour. Ich habe es geschafft. Überlebt, ohne größeren Schaden zu nehmen. Alles was danach kommt, ist ein Spaziergang.
Ganz im Südwesten Ugandas erwartet uns nach den Strapazen der Ruwenzori-Wanderung eines der großen Highlights des Landes: wild lebende Berggorillas. Ja, die knuffigen Wesen aus Gorillas im Nebel. Tiere, die uns Menschen genetisch sehr nahe sind, riesig an Gestalt, massig im Gewicht und leider vom Aussterben bedroht. 700 Tiere gibt es noch. Alle leben in dem Grenzgebiet zwischen Uganda, Ruanda und Kongo. Manche lassen sich nicht von den menschlichen Grenzziehungen beeindrucken, viele scheuen den Menschen, doch ein paar Gruppen sind habituiert, das heißt, die sind in einem langwierigen Prozess an die Nähe der Menschen gewöhnt. Und das hat nicht nur touristische Hintergründe. Durch den mit dem Gorilla-Tracking verbundenen Tourismus strömt Geld ins Land. Schutzgebiete werden eingerichtet, die Bewohner der Umgebung mit der Wichtigkeit des Schutzes vertraut gemacht und Schulen finanziert, da die Menschen nur mit einer guten Ausbildung die Relevanz von Umwelt- und Tierschutz begreifen können. Hier wie dort.
Der Vormittag beginnt mit einer Aufklärung über das Verhalten im Wald. Wir sind zu acht. Drei aus unserer Reisegruppe, zwei aus Kanada, drei Italien. Keine lauten Gespräche im Wald. Keine hastigen Bewegungen. Kein Blitzlicht. Einem Silberrücken niemals in die Augen blicken. Sieben Meter Abstand einhalten. Gut, näher will ich auch erst mal nicht an die Tiere ran. Aus Respekt. Schließlich hat ein Gorilla etwa das zehnfache an Kraft in seinem Arm im Vergleich zum Menschen. Bis zu 250 Kilo bringt ein ausgewachsenes Männchen auf die Waage. Da empfinde ich den Abstand von sieben Metern durchaus als angemessen.
Ein Gruppe afrikanischer Ranger geht weit vor uns zum letzten Nachtnest der Berggorillas voraus. Sie stehen in ständigem Funkkontakt zu unseren Rangern, die uns erst einmal über einen großzügig frei gehaltenen Weg führen. Doch schließlich bekommen sie die Mitteilung, wo sich die anvisierte Gorillagruppe aufhält und wir verlassen den luxuriösen Weg zugunsten eines schmalen Trampelpfades quer durch den dichten Dschungel. Ranken ziehen an meinem T-Shirt, feuchte Luft schlägt mir entgegen, der Weg ist rutschig und die Aufregung steigt, als wir die ersten Spuren der Berggorillas entdecken: In Ermangelung natürlicher Feinde machen die Tiere aus ihrer Anwesenheit keinen Hehl. Wenn sie sich fortbewegen, brechen sie eine breite Schneise in das Gebüsch, fressen die Pflanzen zu beiden Seiten und hinterlassen das, was ihr Verdauungsprozess übrig lässt. Fliegen und Mücken säumen ihren Weg. Und wir folgen ihnen. Vorne die Ranger mit Macheten, hinten ein Ranger mit einem Gewehr auf der Schulter. Angeblich zum Schutz vor anderen wilden Tieren. Die Spuren der Waldelefanten werden wir noch entdecken, und auch mit denen ist nicht zu spaßen, wenn man sie zufällig überrascht.
Ranken ziehen an meinem T-Shirt, feuchte Luft schlägt mir entgegen, der Weg ist rutschig und die Aufregung steigt, als wir die ersten Spuren der Berggorillas entdecken: In Ermangelung natürlicher Feinde machen die Tiere aus ihrer Anwesenheit keinen Hehl. Wenn sie sich fortbewegen, brechen sie eine breite Schneise in das Gebüsch, fressen die Pflanzen zu beiden Seiten und hinterlassen das, was ihr Verdauungsprozess übrig lässt. Fliegen und Mücken säumen ihren Weg. Und wir folgen ihnen. Vorne die Ranger mit Macheten, hinten ein Ranger mit einem Gewehr auf der Schulter. Angeblich zum Schutz vor anderen wilden Tieren. Die Spuren der Waldelefanten werden wir noch entdecken, und auch mit denen ist nicht zu spaßen, wenn man sie zufällig überrascht.
An einem Hang bleiben unsere Ranger plötzlich stehen. Hier sind sie. Sagen sie. Um uns herum Gestrüpp, zwei bis drei Meter hoch. Ein schmaler Pfad schlängelt sich den Berg hoch. Drei sollen es sein. Wir sehen nichts. Doch dann, mit einem Mal, eine Bewegung. Fünfzehn Meter entfernt. Ein schwarzer behaarter Arm. Dann ein Rücken. Schließlich der Kopf. Etwas gelangweilt blicken uns die dunklen Augen an. Ein Schwarzrücken sitzt im Gebüsch, stopft sich mit Blättern voll. Ein riesiger Schwarm Fliegen umgibt ihn. Wir sind gebannt. Ein zweiter Gorilla bricht durch das Unterholz. Noch ein Schwarzrücken. Und dann der dritte. Ein Silberrücken. Jüngere, aber schon ausgewachsene Männchen sind auf dem Rücken schwarz behaart, erst mit höherem Alter färben sich diese Haare silbrig-weiß. Sie beobachten uns hin und wieder mal, lassen sich aber ansonsten nicht beim Fressen stören.
Nach einer Weile beschließen die Ranger, dass wir den Hang erklimmen werden, denn hinter dem kleinen Bergrücken ist der Rest des 17-köpfigen Clans. Doch gerade als wir losgehen wollen, setzt sich der eine Schwarzrücken in Bewegung. Ich kann nicht schnell genug zur Kamera greifen, da ist er schon bei uns. Wir weichen respektvoll in die Sträucher zurück, um ihn vorbei zu lassen. 15 Zentimeter trennen mich von ihm, als er an uns vorbei jagt. Er holt aus. Ein kleiner Stupser für einen Gorilla. Ein schwerer Schlag auf den Oberschenkel für meine Mitreisende direkt neben mir. Weg ist sie. Wir finden sie zwei Meter hinter uns im Gesträuch wieder. Sie lacht, der Puls rast. Der Gorilla hat es sich dreißig Meter weiter mitten auf dem Pfad gemütlich gemacht. Es muss ein riesiger Spaß für ihn sein, Touristen zu ärgern.

Wir bahnen uns einen Weg an ihm vorbei, schlagen uns durch die Büsche. Wir überqueren den Hügel und steigen in das kleine Tal hinab. Hinter uns die drei vom tierischen Empfangsteam. Vor uns eine freie Fläche, auf der drei, vier, sieben oder mehr Gorillas unterschiedlichen Alters und Geschlechts rasten. Wir staunen, fotografieren wie wild. Freuen uns und sind völlig in den Bann dieser Tiere gezogen. Ein Jungtier tollt einmal quer durch die Talsenke. Tiefe Spuren der Waldelefanten künden von ihrer Anwesenheit vor nicht allzu vielen Stunden genau an dieser Stelle. Hinter uns der Hang, an dem sich einer der Schwarzrücken den Weg zu uns herab bahnt. Helles Klopfen erschallt laut hörbar. Das Jungtier richtet sich auf und schlägt sich spielerisch auf die Brust. Die leise Antwort auf das Brustschlagen des Vaters. Ein, zwei, drei Bäume gehen lautstark am Hang zu Boden. Entweder reizten die frischen grünen Blätter an ihren Spitzen, oder sie standen einfach nur im Weg.
Eine Stunde ist schnell vorbei, dann müssen wir wieder gehen. Noch einmal sehen wir den jungen Schwarzrücken, er schaut uns an, als frage er sich, warum wir eigentlich so interessiert gucken. Schließlich ist er doch immer hier.
Lesen Sie auch Teil 1 des Reiseberichts aus Uganda.
Dir gefällt unsere Arbeit?
meinesuedstadt.de finanziert sich durch Partnerprofile und Werbung. Beide Einnahmequellen sind in den letzten Monaten stark zurückgegangen.
Solltest Du unsere unabhängige Berichterstattung schätzen, kannst Du uns mit einer kleinen Spende unterstützen.
Paypal - danke@meinesuedstadt.de
Artikel kommentieren